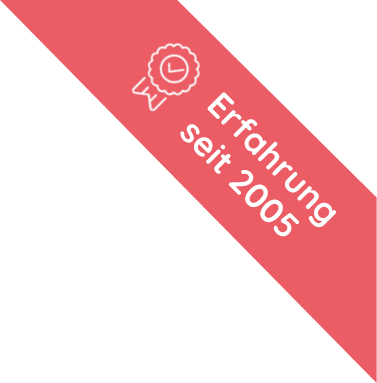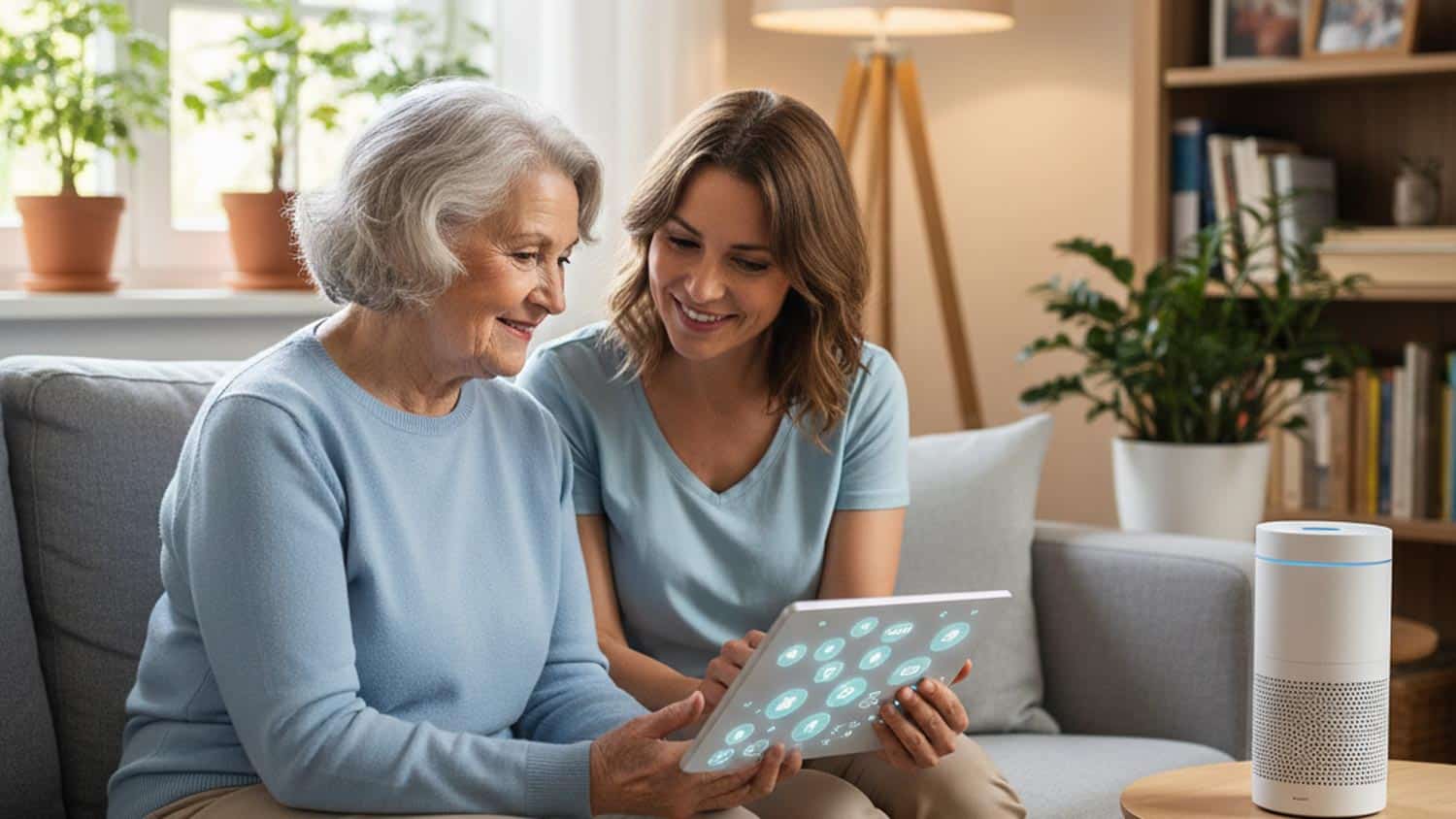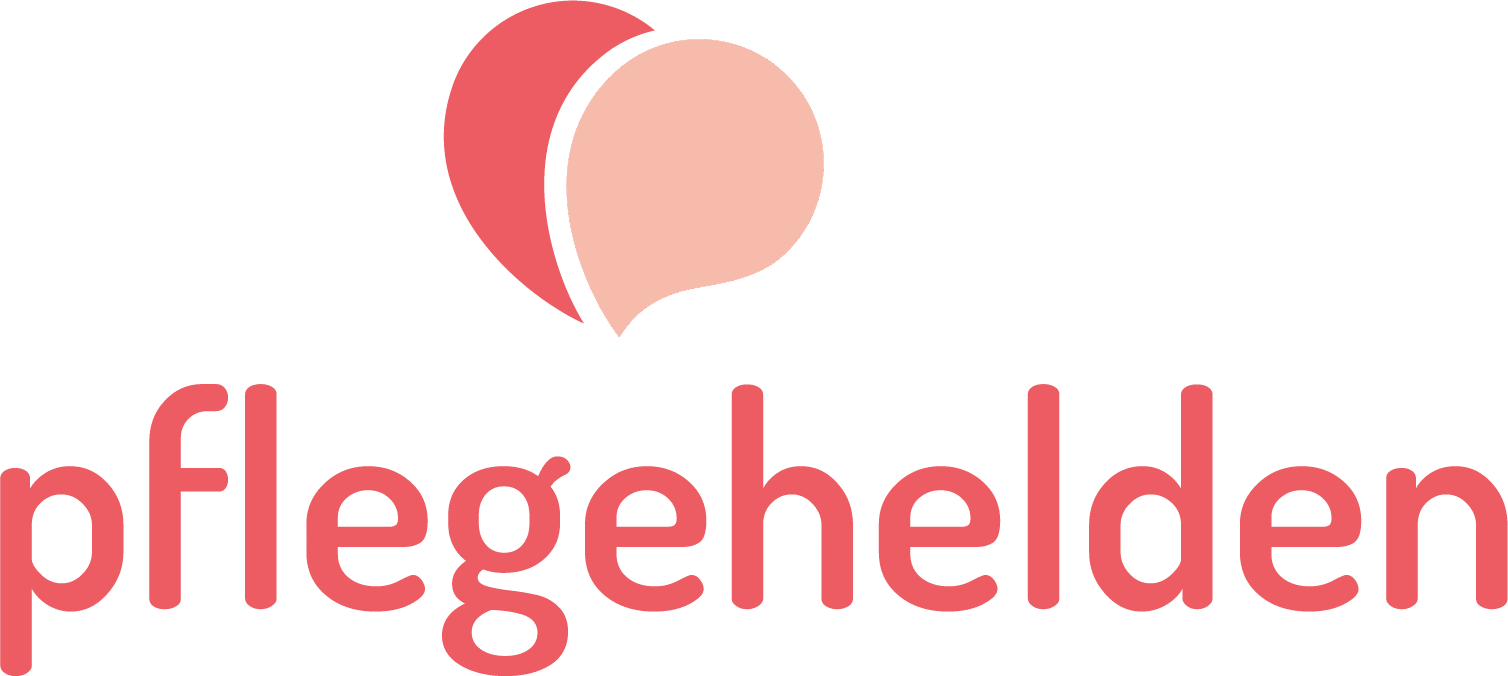- Lesedauer: 6 Minuten
- Leben im Alter
Dekubitus: Symptome, Therapie & Pflege
Wenn die Haut über längere Zeit unter Druck steht, kann sie Schaden nehmen – das nennen Mediziner:innen Dekubitus. Menschen, die viel Zeit im Liegen verbringen, haben ein erhöhtes Dekubitusrisiko. Genau das trifft auf viele Pflegebedürftige hierzulande zu. Doch das „Wundliegen“ ist kein unabwendbares Schicksal. Wenn Sie über die Anzeichen informiert sind, können Sie schnell reagieren. Außerdem gibt es vieles, was Sie vorbeugend tun können.
Das Wichtigste in Kürze
- Ein Dekubitus entsteht, wenn ein zu hoher oder langanhaltender Druck auf die Haut und das Gewebe einwirkt.
- Ein Druckgeschwür fällt anfangs durch eine Rötung auf, später kann daraus eine tief liegende Wunde werden, die oft nur schlecht heilt.
- Mediziner:innen behandeln einen Dekubitus mit speziellen Wundauflagen und empfehlen Lagerungstechniken.
- Pflegende Angehörige stellen ihr Familienmitglied mit auffälligen Hautstellen am besten umgehend zunächst beim Hausarzt vor.
- Zur Vorbeugung sind eine regelmäßige Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr, Bewegung/Lagerung und die Behandlung von Grunderkrankungen wie Diabetes wichtig.
Was ist ein Dekubitus?
Ein Dekubitus, auch als Druckgeschwür bezeichnet, ist eine Schädigung der Haut und des darunterliegenden Gewebes, die durch andauernden Druck auf eine bestimmte Körperstelle entsteht. Dieser Druck stört die Durchblutung. Dadurch erhalten die Haut und das Gewebe nicht mehr genug Sauerstoff und Nährstoffe – sie nehmen kontinuierlich Schaden. Anfangs ist es vielleicht „nur“ eine Rötung, aber ohne Entlastung kann sich daraus eine tiefgehende Wunde entwickeln, die schlimmstenfalls bis zum Knochen reicht. Besonders gefährdet sind Menschen, die bettlägerig sind oder viel Zeit im Rollstuhl verbringen. Ein Dekubitus ist für Ihren Angehörigen nicht nur schmerzhaft, sondern kann auch ernsthafte Komplikationen mit sich bringen. Sobald die Haut offen ist, können Keime eindringen und Infektionen verursachen. Gerade im Bereich des Gesäßes besteht die Gefahr, dass Bakterien aus dem Stuhl in die Wunde gelangen. Das geschieht unbemerkt, auch wenn Sie viel Wert auf die Körperpflege und auf ein hygienisches Pflegeumfeld legen. Im schlimmsten Fall kann sich aus der Verunreinigung eine schwere Entzündung oder sogar eine Blutvergiftung entwickeln.
Gut zu wissen
In Deutschland entsteht Schätzungen zufolge jedes Jahr bei mehr als 400.000 Menschen ein behandlungsbedürftiger Dekubitus. Eindeutige Zahlen, vor allem für die häusliche Versorgung, gibt es aber nicht.
Wie und wo entsteht ein Dekubitus?
Ein Dekubitus entsteht immer dort, wo über längere Zeit zu viel Druck auf eine bestimmte Körperregion ausgeübt wird. Als mobiler Mensch lagern Sie sich automatisch mehrmals tagsüber, und selbst im Schlaf um. Damit erhalten die Haut und das Gewebe regelmäßig Entlastung. Das funktioniert bei älteren Menschen mit körperlichen und sensorischen Einschränkungen aber oft nicht mehr. Sie spüren mitunter nicht, wann sie sich umlagern müssen und selbst wenn, sind sie dazu häufig nicht in der Lage. Besonders gefährdet sind dann Körperbereiche, an denen die Haut direkt über einem Knochen liegt und wenig Polsterung durch Muskeln oder Fett vorhanden ist. Mediziner:innen nennen diese Körperbereiche Prädilektionsstellen, also bevorzugt betroffene Körperstellen bei einem Dekubitus.
Dekubitus-Prädilektionsstellen im Überblick:
| Körperposition | Besonders gefährdete Körperbereiche |
| Rückenlage | Hinterkopf, Schultern, Wirbelsäule, Bereich um das Kreuzbein (Steiß), Fersen |
| Bauchlage | Stirn, Wangenknochen, Schultern, Brustbereich, Ellenbogen, Hüftknochen, Knie (Kniescheiben), Fußspitzen |
| Seitenlage (90°) | Schläfen, Ohr, Schultern, Rippen, Ellenbogen, Hüftknochen (seitlicher Oberschenkel), Knieaußenseite, Wadenbein, seitliche Knöchel |
| Sitzposition (z. B. im Rollstuhl) | Hinterkopf (wenn angelehnt), Schultern, Wirbelsäule, Ellenbogen, Sitzbeinhöcker, Fersen (bei Kontakt mit Stuhl oder Fußstützen) |
Scherkräfte und andere Risikofaktoren bei Dekubitus
Nicht nur anhaltender Druck kann die Haut Ihres Angehörigen belasten, auch sogenannte Scherkräfte spielen eine Rolle bei der Entstehung von Druckgeschwüren. Diese Kräfte entstehen zum Beispiel, wenn Pflegebedürftige im Bett hochgezogen, langsam nach unten rutschen oder zur Seite gedreht werden. Dabei kommt es zu einer Verschiebung der einzelnen Haut- und Gewebeschichten gegeneinander. Das hat zur Folge, dass kleine Blutgefäße abgeknickt oder verdrillt werden – die Durchblutung gerät ins Stocken, und das betroffene Gewebe wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Auch Diabetes, Hauterkrankungen, die periphere arterielle Verschlusskrankheit, neurologische Erkrankungen wie Demenz oder Neuropathien erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Haut Schaden nimmt. Außerdem sind Menschen mit einem chronischen Alkohol- oder Tabakkonsum, mit Unter- oder Übergewicht und mit wenig Trinkzufuhr eher gefährdet.
So erkennen Sie ein Druckgeschwür im Pflegealltag
Wenn Sie einen Angehörigen pflegen, übernehmen Sie wahrscheinlich einen Teil der Körperpflege oder alle Aufgaben dabei. Duschen Sie Ihren Angehörigen oder cremen Sie ihn ein, werfen Sie immer einen Blick auf die Haut – ein Druckgeschwür erkennen Sie hier, je nach Dekubitus-Grad, an verschiedenen Symptomen.
Dekubitus-Gradeinteilung:
- Stadium 1: Vielleicht fällt Ihnen auf, dass eine bestimmte Hautstelle gerötet ist, etwa an der Ferse, am Gesäß oder am Rücken. Wenn Sie sanft darauf drücken und die Rötung nicht verschwindet, kann das ein erstes Anzeichen sein. Die Haut ist an dieser Stelle noch intakt, aber sie fühlt sich vielleicht wärmer an, empfindlich oder gespannt.
- Stadium 2: Hier ist die Haut bereits sichtbar geschädigt. Es kann sich eine Blase gebildet haben oder eine kleine offene Wunde, die wie eine Abschürfung aussieht. Ihr Angehöriger klagt womöglich über Schmerzen oder Sie bemerken, dass er Berührungen an dieser Stelle als unangenehm empfindet.
- Stadium 3: In diesem Stadium ist die Haut vollständig durchbrochen und auch das darunterliegende Gewebe ist betroffen. Die Wunde kann tief sein und wirkt oft wie ein Krater. Sie sehen möglicherweise abgestorbenes Gewebe oder gelbliche Beläge.
- Stadium 4: Dies ist das schwerste Stadium. Die Wunde reicht nun bis auf Muskeln, Sehnen oder sogar Knochen. Manchmal ist die Umgebung stark entzündet und es besteht ein hohes Infektionsrisiko. Eine solche Wunde ist für Ihr Familienmitglied nicht nur schmerzhaft, sondern auch gefährlich.
Wie wird ein Dekubitus diagnostiziert?
Bemerken Sie bei Ihrem Angehörigen eine auffällige Hautstelle, sollten Sie diese unbedingt abklären lassen. Der erste Ansprechpartner ist die Hausarztpraxis. Hausärzt:innen können eine Einschätzung vornehmen und bei Bedarf an Dermatolog:innen oder Wundchirug:innen weiter überweisen. Für die Diagnose eines Dekubitus wenden Mediziner:innen zunächst den Fingertest an. Sie drücken sanft auf die betreffende Hautstelle und beobachten, was passiert. Gesunde Haut verfärbt sich erst weiß und dann wieder rot. Bei einem Dekubitus bleibt die Stelle kontinuierlich rot. Ärzt:innen können bei Entzündungsanzeichen einen Abstrich aus der Wunde entnehmen, um mehr über die verursachenden Bakterien zu erfahren. Begleitend dazu führen sie in der Regel eine Blutuntersuchung durch. Ist das Druckgeschwür sehr ausgeprägt, greifen Mediziner:innen auf bildgebende Untersuchungen, wie ein MRT, CT, Ultraschall oder Röntgen zurück, um den Schaden besser beurteilen zu können.
Dekubitus-Therapie: Lagerung und Wundversorgung bei Dekubitus
Steht die Diagnose Dekubitus fest, handeln die Mediziner:innen in Abhängigkeit von der erkrankten Hautstelle und dem Schweregrad. Grundsätzlich ist es wichtig, die Körperregion zu entlasten. Dabei helfen eine Dekubitus-Matratze, ein Dekubitus-Kissen und spezielle Dekubitus-Lagerungen. Befindet sich Ihr Angehöriger im Stadium eins, reichen diese entlastenden Maßnahmen meist aus. Hat sich das Druckgeschwür bereits zu einer Wunde entwickelt, wird Ihr Familienmitglied mit Wundauflagen versorgt. Sie erfüllen verschiedene Aufgaben. Zum einen decken sie die Wunde ab und verhindern so Reibung, sie schützen aber auch vor Infektionen und halten die Wunde für eine bestmögliche Heilung feucht. Beim Verbandswechsel wird die Wunde dann zusätzlich gereinigt. Im Stadium drei und Stadium vier wird bei Ihrem Angehörigen die sogenannte Wundtoilette, auch als Débridement bezeichnet, durchgeführt. Dabei entfernen speziell geschulte Personen, wie Wundexpert:innen, abgestorbenes Gewebe mit einer Pinzette oder einem Skalpell. Je nach Ausgangsbefund sind vielleicht weitere Behandlungen, zum Beispiel mit Antibiotika oder eine Hauttransplantation nötig. Hat Ihr Familienmitglied starke Schmerzen, verordnen Mediziner:innen besondere Schmerzmittel, ansonsten reichen frei erhältliche Präparate aus der Apotheke aus.
Gut zu wissen
Damit der Dekubitus ausheilen und neuen Druckgeschwüren vorgebeugt werden kann, behandeln Mediziner:innen auch Risikofaktoren, zum Beispiel eine vorliegende Diabetes-Erkrankung oder Mangelernährung.
So beugen Sie einem Dekubitus in der häuslichen Pflege vor
Die Heilung von Druckgeschwüren ist oft langwierig, vor allem, wenn sie sehr in die Tiefe gehen. Das liegt bei vielen Menschen daran, dass sie Risikofaktoren mitbringen, die eine optimale Durchblutung ohnehin erschweren. Die gute Nachricht: Mit ein paar einfachen, aber konsequenten Maßnahmen können Sie viel dazu beitragen, dass die Haut Ihres Angehörigen gesund bleibt.
- Regelmäßiges Umlagern/Bewegung: Wechseln Sie die Liege- oder Sitzposition Ihres Angehörigen mindestens alle zwei Stunden. So vermeiden Sie, dass die Haut und das Gewebe zu lange an einer Stelle unter Druck stehen. Dabei ist es wichtig, die Bewegung sanft und schonend auszuführen, um keine zusätzlichen Scherkräfte zu erzeugen. Besitzt Ihr Angehöriger noch eine Restmobilität, motivieren Sie ihn zu kleinen Bewegungsübungen – das klappt auch auf der Bettkante.
- Hautpflege und Hautkontrolle: Inspizieren Sie die Haut täglich, vor allem an gefährdeten Stellen wie Fersen, Kreuzbein, Schultern oder Ohrmuscheln. Reinigen Sie die Haut behutsam und halten Sie sie trocken, aber nicht zu trocken. Verwenden Sie pflegende Cremes, die die Haut schützen und geschmeidig halten.
- Feuchtigkeit vermeiden: Feuchtigkeit durch Schwitzen oder Inkontinenz weicht die Haut auf und macht sie empfindlicher für Schäden. Wechseln Sie nasse Kleidung sowie Bettwäsche sofort und sorgen Sie für eine gute Belüftung der Haut.
- Ernährung und Flüssigkeitszufuhr: Achten Sie darauf, dass Ihr Angehöriger ausreichend trinkt und sich ausgewogen ernährt. Eine gute Versorgung mit Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen unterstützt die Hautgesundheit und die Wundheilung.
- Hilfsmittel nutzen (Dekubitus-Prophylaxen): Setzen Sie bei Bedarf spezielle Hilfsmittel ein, wie druckentlastende Matratzen, Lagerungskissen oder Sitzkissen. Diese helfen, den Druck auf gefährdete Stellen zu reduzieren. Die behandelnden Mediziner:innen oder Personen vom ambulanten Pflegedienst können Ihnen dazu wertvolle Tipps geben.
FAQ – Häufig gestellte Fragen rund um Dekubitus
Wie erkennen pflegende Angehörige einen beginnenden Dekubitus?
Ein erstes Warnzeichen ist eine Rötung, die sich nicht zurückbildet, wenn man leicht darauf drückt. Die Haut kann auch warm, hart oder schmerzhaft sein.
Wie häufig sollten Angehörige Pflegebedürftige umlagern?
Expert:innen raten häufig zu einer Umlagerung alle zwei Stunden. Hier kommt es aber auf die Restmobilität und das Hautbild des Pflegebedürftigen an.
Dürfen pflegende Angehörige die Wunde selbst versorgen?
Pflegende Angehörige sollten nur oberflächliche Hautveränderungen, wie Rötungen, mit Hautpflege behandeln. Offene oder tiefe Wunden müssen immer von Fachpersonal versorgt werden.